AW: [DE] »I weiß ja net, wie hart Sie sind« – Schauriges und Schönes vom Westweg
Tag 7 (Mittwoch, 18.09.): Pausentag auf dem Brend
Der Forstsachverständige W. ist beruflich hier und begutachtet den Staatswald, indem er auf bestimmten Flächen Höhe und Stammumfang der Bäume, die Naturverjüngung und diverse andere Parameter bestimmt. So habe ich mir das erklären lassen. Irgendwann sind wir nämlich doch ins Gespräch gekommen, zuerst wohl über meinen, dann über seinen Beruf, genau weiß ich es nicht mehr.


Als wir morgens vor der Tür stehen und das Wetter begutachten, ist für beide klar, dass wir einen Pausentag haben. W. wird einige Stunden mit Aktenordnern und Laptop hantieren, um Daten einzugeben. Ich hingegen kümmere mich um meine Wäsche, später verbringe ich einige Zeit mit den Wanderkarten und dem eingangs erwähnten Wanderbuch über den Schwarzwald, das ich im Bücherschrank gefunden habe. Da ich heute einen Tag verliere, ist das ursprüngliche Ziel, über Feldberg und Belchen ins Münstertal zu laufen (und von dort nach Freiburg zu meinem Bruder zu fahren), nicht mehr realistisch. Ich suche mir also eine neue Route, die früher vom Westweg abzweigt und über St. Märgen und St. Peter Richtung Freiburg führt. Klöster besichtigen. Rokoko kommt mir jetzt gerade recht, nach all dem Regen.
Ebenfalls in jenem Wanderbuch stoße ich auf die Geschichte des Königenhofes: größte Lawinenkatastrophe in der Geschichte des Schwarzwaldes. Der Hof lag zwischen Neukirch und Glashütte (nicht allzu weit von der Kalten Herberge) in einem engen Tal. Der Bauer hatte den Wald am Steilhang oberhalb des Hofes gerodet, um das Holz an die Glashütte zu verkaufen. In einer Sturmnacht Ende Februar 1844 wurde der Hof von einer Nassschneelawine getroffen, bei der das Haupthaus um mehr als zehn Meter verschoben und teilweise verschüttet wurde. Von den 24 Bewohnern überlebten nur sieben.
So erzählt es das Buch, und so ähnlich kann man es auch im Internet nachlesen. Auf der Karte stelle ich fest, dass der Ort eingezeichnet ist, aber es gibt dort jetzt nur noch eine Grillhütte. Den Weg durchs Tal abseits des Westwegs scheue ich wegen der zusätzlichen Höhenmeter. Aber die Geschichte bleibt im Kopf, als Ausgangspunkt für die Überlegung, ob nicht auch eine ganz andere Art des Wanderns, eine Art Arealforschung in einem bestimmten Gebiet möglich wäre, verbunden zum Beispiel mit einer Katalogisierung aller vorhandenen Schutzhütten.
Dem Westweg folge ich schon aus Bequemlichkeit, weil er, von den Abstiegen bei Forbach, Hausach und Titisee abgesehen, auf der Höhe bleibt. Auf die Dauer ist das aber auch topografisch unbefriedigend: Manchmal würde ich gern unten durchs Tal laufen, und manchmal würde ich gern das Tal, in das ich hinuntersehe, noch einmal von der anderen Seite sehen. Das geht beim Streckenwandern kaum. Der Westweg ist ein Weg, auf dem man unentwegt an Landschaften vorbeiläuft, für die man keine Zeit hat.
Am Nachmittag, als der Regen etwas nachlässt, mache ich einen Spaziergang zum Goldenen Raben, der ›nächsten Einkehrmöglichkeit in Laufrichtung‹ (wenn man den Berggasthof auf dem Brend mal nicht mitzählt). Nebenbei werfe ich einen Blick auf den Brendturm, einen kleinen Aussichtsturm, aber das Hinaufsteigen wäre heute ziemlich sinnlos.

Blick vom Brend nach Westen
Der Weg bis zum Raben ist unspektakulär, eigentlich ein weitgehend ebenes Sträßchen zwischen den Wiesen, und an mancher Ecke könnte man sich im Münsterland wähnen, wären da nicht die im Kraftfahrzeugtempo aus dem Wald hervorbrechenden und über den Kamm hastenden Wolkenfetzen. So eilig habe ich es heute nicht.
Das Hotel Zum Goldenen Raben liegt an windgeschützter Stelle, und betritt man die Gaststube, bleibt zusätzlich auch noch die Zeit stehen. Außer der Linzertorte wirkt alles irgendwie alt. Zwei mitteljunge Gäste sitzen immerhin da, und natürlich verstricke ich sie sofort in ein Gespräch (so dass die Wirtin mich später fragt, ob sie mir den Cappuccino noch einmal aufwärmen soll). Die beiden kommen aber trotzdem noch zu Wort und erzählen, dass sie den Westweg von Süden nach Norden laufen. Zuhause sind sie in Lenzkirch – deshalb haben sie nach einer der ersten Etappen in der eigenen Wohnung übernachtet.
Ich erzähle von meinem gestrigen Telefonat mit dem Naturfreundehaus, und die Wirtin amüsiert sich; natürlich seien die Herbergen zu dieser Zeit bei diesem Wetter ziemlich leer. Was den Regen angehe, sei es ja so, dass manche Einheimische nicht so unglücklich darüber seien. Der Sommer war nämlich dieses Jahr so trocken, dass manche Höfe kein Wasser mehr hatten und von ihren Nachbarn mitversorgt werden mussten.
Auf dem Rückweg schüttet es wieder. In Höhe des Brendturms und der im ODS-Schutzhüttenverzeichnis aufgeführten Grillhütte staken vereinzelte Damen mit giftgrünen Quechua-Raincovers den Westweg entlang. Ich sehe genauer hin, dann erkennt man einander: die französische Alpenvereinsgruppe vom Brandenkopf. Ich wähnte sie ja vor mir, aber in Wirklichkeit sind sie vorgestern vom Brandenkopf nur bis nach Hausach gelaufen und haben dort übernachtet, während ich auf dem Farrenkopf war. Heute sehe ich sie freilich zum letzten Mal.
Später, beim Abendessen mit W., taucht auch das Paar aus Lenzkirch im Naturfreundehaus auf. Sie wissen noch nicht, wo sie übernachten sollen – hier oder in einer Schutzhütte. Wir geben ihnen keine eindeutige Empfehlung. Als es schon fast dunkel ist, brechen die beiden auf, um die Schutzhütte beim Günterfelsen zu suchen, die ich gestern nicht gesehen habe.
Den weiteren Abend verbringe ich mit W. im Fernsehraum. SSC Neapel gegen Borussia Dortmund. Nach dem 1:0 tippt W. (der anfangs ununterbrochen kommentiert) auf 1:1, ich halte mit 4:0 dagegen und behalte zumindest insoweit recht, als die Neapolitaner gewinnen und beim 2:1 alle Tore selbst schießen.
Tag 7 (Mittwoch, 18.09.): Pausentag auf dem Brend
Der Forstsachverständige W. ist beruflich hier und begutachtet den Staatswald, indem er auf bestimmten Flächen Höhe und Stammumfang der Bäume, die Naturverjüngung und diverse andere Parameter bestimmt. So habe ich mir das erklären lassen. Irgendwann sind wir nämlich doch ins Gespräch gekommen, zuerst wohl über meinen, dann über seinen Beruf, genau weiß ich es nicht mehr.


Als wir morgens vor der Tür stehen und das Wetter begutachten, ist für beide klar, dass wir einen Pausentag haben. W. wird einige Stunden mit Aktenordnern und Laptop hantieren, um Daten einzugeben. Ich hingegen kümmere mich um meine Wäsche, später verbringe ich einige Zeit mit den Wanderkarten und dem eingangs erwähnten Wanderbuch über den Schwarzwald, das ich im Bücherschrank gefunden habe. Da ich heute einen Tag verliere, ist das ursprüngliche Ziel, über Feldberg und Belchen ins Münstertal zu laufen (und von dort nach Freiburg zu meinem Bruder zu fahren), nicht mehr realistisch. Ich suche mir also eine neue Route, die früher vom Westweg abzweigt und über St. Märgen und St. Peter Richtung Freiburg führt. Klöster besichtigen. Rokoko kommt mir jetzt gerade recht, nach all dem Regen.
Ebenfalls in jenem Wanderbuch stoße ich auf die Geschichte des Königenhofes: größte Lawinenkatastrophe in der Geschichte des Schwarzwaldes. Der Hof lag zwischen Neukirch und Glashütte (nicht allzu weit von der Kalten Herberge) in einem engen Tal. Der Bauer hatte den Wald am Steilhang oberhalb des Hofes gerodet, um das Holz an die Glashütte zu verkaufen. In einer Sturmnacht Ende Februar 1844 wurde der Hof von einer Nassschneelawine getroffen, bei der das Haupthaus um mehr als zehn Meter verschoben und teilweise verschüttet wurde. Von den 24 Bewohnern überlebten nur sieben.
So erzählt es das Buch, und so ähnlich kann man es auch im Internet nachlesen. Auf der Karte stelle ich fest, dass der Ort eingezeichnet ist, aber es gibt dort jetzt nur noch eine Grillhütte. Den Weg durchs Tal abseits des Westwegs scheue ich wegen der zusätzlichen Höhenmeter. Aber die Geschichte bleibt im Kopf, als Ausgangspunkt für die Überlegung, ob nicht auch eine ganz andere Art des Wanderns, eine Art Arealforschung in einem bestimmten Gebiet möglich wäre, verbunden zum Beispiel mit einer Katalogisierung aller vorhandenen Schutzhütten.
Dem Westweg folge ich schon aus Bequemlichkeit, weil er, von den Abstiegen bei Forbach, Hausach und Titisee abgesehen, auf der Höhe bleibt. Auf die Dauer ist das aber auch topografisch unbefriedigend: Manchmal würde ich gern unten durchs Tal laufen, und manchmal würde ich gern das Tal, in das ich hinuntersehe, noch einmal von der anderen Seite sehen. Das geht beim Streckenwandern kaum. Der Westweg ist ein Weg, auf dem man unentwegt an Landschaften vorbeiläuft, für die man keine Zeit hat.
Am Nachmittag, als der Regen etwas nachlässt, mache ich einen Spaziergang zum Goldenen Raben, der ›nächsten Einkehrmöglichkeit in Laufrichtung‹ (wenn man den Berggasthof auf dem Brend mal nicht mitzählt). Nebenbei werfe ich einen Blick auf den Brendturm, einen kleinen Aussichtsturm, aber das Hinaufsteigen wäre heute ziemlich sinnlos.

Blick vom Brend nach Westen
Der Weg bis zum Raben ist unspektakulär, eigentlich ein weitgehend ebenes Sträßchen zwischen den Wiesen, und an mancher Ecke könnte man sich im Münsterland wähnen, wären da nicht die im Kraftfahrzeugtempo aus dem Wald hervorbrechenden und über den Kamm hastenden Wolkenfetzen. So eilig habe ich es heute nicht.
Das Hotel Zum Goldenen Raben liegt an windgeschützter Stelle, und betritt man die Gaststube, bleibt zusätzlich auch noch die Zeit stehen. Außer der Linzertorte wirkt alles irgendwie alt. Zwei mitteljunge Gäste sitzen immerhin da, und natürlich verstricke ich sie sofort in ein Gespräch (so dass die Wirtin mich später fragt, ob sie mir den Cappuccino noch einmal aufwärmen soll). Die beiden kommen aber trotzdem noch zu Wort und erzählen, dass sie den Westweg von Süden nach Norden laufen. Zuhause sind sie in Lenzkirch – deshalb haben sie nach einer der ersten Etappen in der eigenen Wohnung übernachtet.
Ich erzähle von meinem gestrigen Telefonat mit dem Naturfreundehaus, und die Wirtin amüsiert sich; natürlich seien die Herbergen zu dieser Zeit bei diesem Wetter ziemlich leer. Was den Regen angehe, sei es ja so, dass manche Einheimische nicht so unglücklich darüber seien. Der Sommer war nämlich dieses Jahr so trocken, dass manche Höfe kein Wasser mehr hatten und von ihren Nachbarn mitversorgt werden mussten.
Auf dem Rückweg schüttet es wieder. In Höhe des Brendturms und der im ODS-Schutzhüttenverzeichnis aufgeführten Grillhütte staken vereinzelte Damen mit giftgrünen Quechua-Raincovers den Westweg entlang. Ich sehe genauer hin, dann erkennt man einander: die französische Alpenvereinsgruppe vom Brandenkopf. Ich wähnte sie ja vor mir, aber in Wirklichkeit sind sie vorgestern vom Brandenkopf nur bis nach Hausach gelaufen und haben dort übernachtet, während ich auf dem Farrenkopf war. Heute sehe ich sie freilich zum letzten Mal.
Später, beim Abendessen mit W., taucht auch das Paar aus Lenzkirch im Naturfreundehaus auf. Sie wissen noch nicht, wo sie übernachten sollen – hier oder in einer Schutzhütte. Wir geben ihnen keine eindeutige Empfehlung. Als es schon fast dunkel ist, brechen die beiden auf, um die Schutzhütte beim Günterfelsen zu suchen, die ich gestern nicht gesehen habe.
Den weiteren Abend verbringe ich mit W. im Fernsehraum. SSC Neapel gegen Borussia Dortmund. Nach dem 1:0 tippt W. (der anfangs ununterbrochen kommentiert) auf 1:1, ich halte mit 4:0 dagegen und behalte zumindest insoweit recht, als die Neapolitaner gewinnen und beim 2:1 alle Tore selbst schießen.
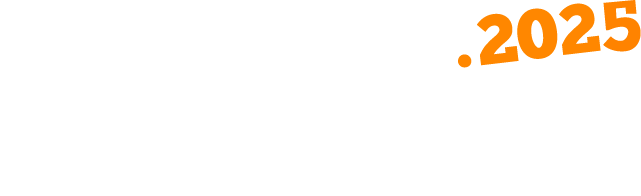







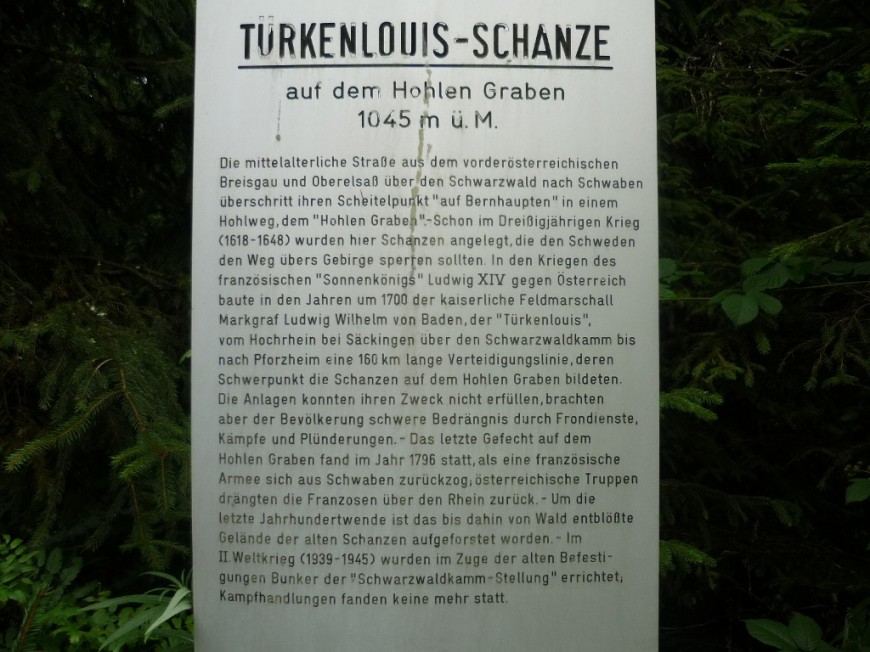




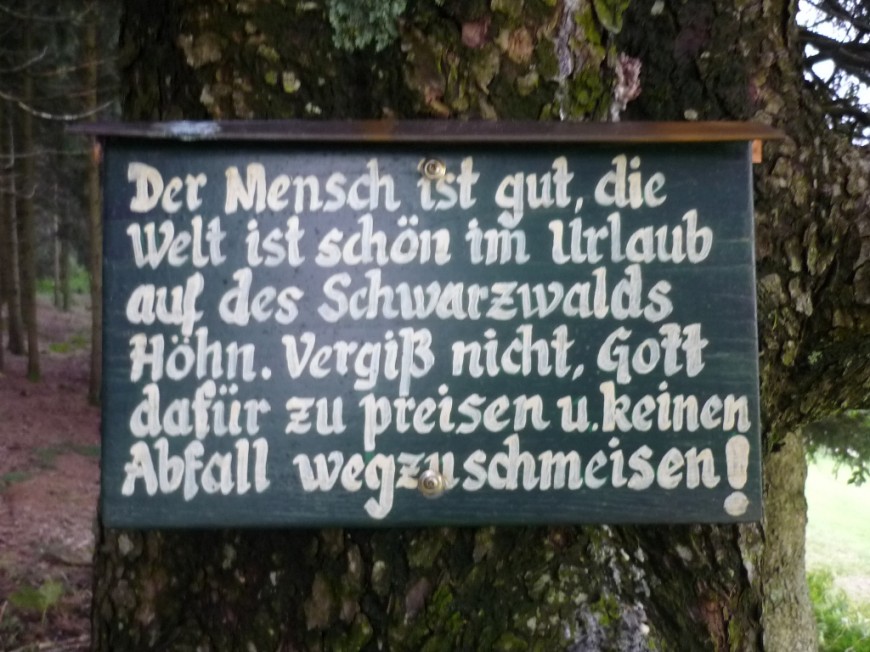
























Kommentar